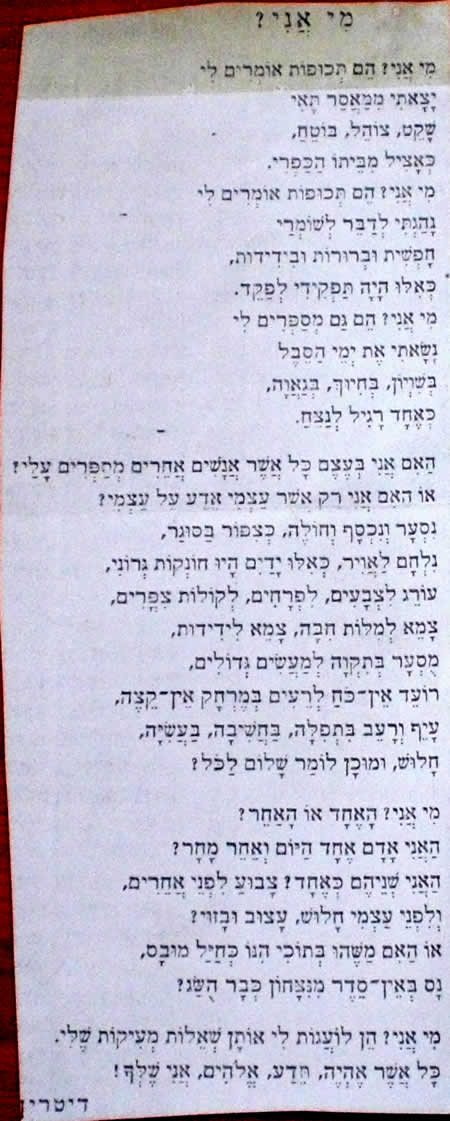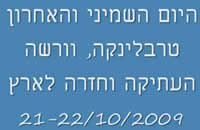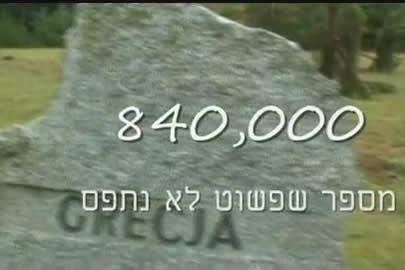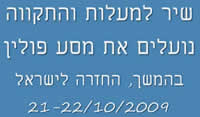Ruediger: Lichtblick
Auschwitz
Zeugnis ablegen
Im Zug
Die Fahrt war ganz anders als erwartet. Urlaub von Anfang an...
Schon der erste Regionalzug, der mich von meinem Städtchen
zum Nachtzug nach Warschau bringen sollte, hatte eine halbe
Stunde Verspätung. Aber ich kam noch rechtzeitig zum Anschlusszug.
Im Liegewagenabteil ruhten bereits fünf Personen. Unten
rechts war für mich noch frei.
Das Abteil war völlig abgedunkelt, der schmale Gang zwischen
den Betten stand voller Gepäck und als ich mich schließlich
in meine Koje gezwängt hatte, funktionierte die Leselampe
nicht. Ich nahm einen Schluck Weinbrand, trank einen Becher
Tee aus der Thermoskanne und schlief ein.
Nichts von der Atmosphäre des enteilenden Zuges, der mich
fortträgt, weg vom Bekannten hin zu einer anderen Welt.
Keine dahinfließenden Landschaften, Lichter, Bahnhöfe
und keine melancholischen Gedanken an das was war und das was
kommen wird.
Um sechs Uhr früh umsteigen in Poznan auf einen Regionalzug
nach Breslau. Der Geruch von Kohlenöfen in der Luft. Ich
fühle mich erinnert an die DDR, vielleicht meine frühe
Kindheit. Diese Art Kohlengeruch gibt es im Ruhrgebiet schon
lange nicht mehr.
In Breslau noch einmal umsteigen auf den Zug nach Krakow. Ankunft
13:15 Uhr. In vier Stunden werde ich dort sein.
Im Gepäck ein Buch über Microsofts neueste Produkte,
denn vor zwei Tagen habe ich einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben
und in zwei Wochen werde ich anfangen mit Bill Gates Produkten
zu arbeiten. Ich hatte wahrlich nicht die Absicht meine Arbeit
auf diese Reise mitzunehmen. Aber während der fünf
Monate, die ich mich bewarb, hatte ich deutlich erfahren, welche
Ängste, welche Furcht, Niedergeschlagenheit und Verzweiflung
die drohende Arbeitslosigkeit in mir hervorrief. Einmal mehr
musste ich erkennen, wie dünn der Halt in mir selbst ist,
wie schnell ich mich haltlos fühle, wenn die äußeren
Bedingungen mir den erstrebten Zuspruch verweigern.
Jetzt bin ich auf dem Weg nach Krakow und morgen geht es weiter
nach Auschwitz.
Auschwitz – Synonym für die schlimmsten
Verbrechen, die im deutschen Namen begangen wurden. Synonym
für das größte Menschheitsverbrechen im vergangenen
Jahrhundert vielleicht seit Menschengedenken.
Was zieht mich an diesen Ort? Warum will ich dort eine ganze
Woche verbringen?
Ich kann mir die Frage nicht leicht beantworten. Aber ich spüre
die Gravitation dieses Ortes, spüre wie er seine Anziehung
auf mich ausübt, wie er mich ruft. Dieser winzige Punkt
auf der Weltkarte zieht mich an wie ein schwarzes Loch, wo Zeit
und Raum ihre Gültigkeit verlieren, aufhören zu existieren...
Draußen regnet es aus einem grauen polnischen Himmel.
Die Landschaft fließt im tristen braunen Novemberkleid.
Bald sind wir in Krakow.
Im Hotel
Kurz vor dem Ausstieg in Krakow stellte sich heraus, dass Amelie,
die mit mir im Abteil saß, ebenfalls zum Hotel Saski musste.
Auch sie ist gekommen, um Zeugnis abzulegen, eine Woche lang
in Auschwitz. Das Hotel Saski war der Treffpunkt für die
Teilnehmer aus aller Welt. Hier habe ich mich vor zwei Stunden
bei den Veranstaltern angemeldet, der Peacemaker Gemeinschaft
Polen. Von hier startet morgen Früh das Programm.
Knapp 60 Teilnehmer werden es sein. Viele sind zu einem gemeinsamen
informellen Essen aus. Mir war nicht danach. Nicht nur Erschöpfung,
Tagebuch und .NET Crashkurs halten mich ab. Es ist auch Scheu
vor den Menschen, die mich zurückhält. Zudem hatte
ich mit Amelie gegen zwei sehr gut in einem Lokal gespeist.
Es befand sich in einem geschmackvoll eingerichteten Kellergewölbe.
Wir saßen direkt vor dem offenen Kaminfeuer. Amelie erzählte
mir von ihren Erfahrungen im letzten Jahr, als sie das erste
Mal in Auschwitz war. Auf ihre Frage wie ich den Weg hierher
gefunden hatte erzählte ich eine lange Geschichte... Doch
das Wie beantwortet nicht das Warum?
Gleich mir machte Amelie die Erfahrung, dass die Menschen, denen
sie von ihrer Teilnahme an einem Retreat in Auschwitz berichtete,
mit Befremden, Unverständnis eher ablehnend als zustimmend
reagierten. ”Warum?”, fragen sie.
Vielleicht werde ich in einer Woche so etwas wie eine Antwort
darauf haben...
Montag:
Das .NET Framework begleitete mich in den Schlaf und auch in
meinen Träumen. Etwas missmutig und verkatert erwache ich
zu spät und muss mich beim Frühstück eilen. Als
ich mit meinem Gepäck vor die Hoteltür trete begrüßen
mich ein blauer Himmel, milde Luft und Sonnenschein. Welch eine
Überraschung.
Wir starten zur Besichtigung von Kasimierz, dem ehemaligen jüdischen
Viertel von Krakau. Im Bus ein Gespräch mit Anja aus North
Carolina. Ihre Eltern sind polnische Juden, die dem Holocaust
entkamen und nach dem Krieg nach Kanada auswanderten. Sie ist
sehr nett, mütterlich. Es fällt mir schwer ihr meine
Geschichte zu erzählen. Trotzdem merkt sie meine innere
Bewegtheit, versteht mich irgendwie. Es sei gut für meine
Kinder, dass ich das hier mache, sagt sie mir.
Unter kundiger Führung durchqueren wir Kasimierz auf den
Spuren jüdischer Kultur, jüdischen Lebens und jüdischen
Leidens. Seit Schindlers Liste und dem Ende des Kommunismus
ist das Viertel zu neuem Leben erwacht, bevölkert von Künstlern
und Studenten. Überall wird renoviert und herausgeputzt.
Ich empfinde die Atmosphäre als sehr angenehm. Es ist ein
friedvoller Alltag an einem ungewöhnlich milden Novembertag.
Mittags sitze ich mit Amelie und Ohad, einem chassidischen Rabbiner
oder ZEN-juddist, wie er sich lachend bezeichnet, vor einem
Lokal um einen kleinen Tisch in der Sonne. Wir essen, reden
über dies und das und hören im Hintergrund das unentwegte
Klappern einer alten Schreibmaschine. Alt und Neu begegnen sich
unmittelbarer hier als daheim, scheint es mir. Vielleicht ist
es auch nur die veränderte Wahrnehmung eines Reisenden
in der Fremde...
Um zwei steigen wir in den Bus, der uns nach Auschwitz bringen
soll. Neben mir sitzt Kris, ein Pole aus Lublin. Auch er spürt
meine Betroffenheit, als ich versuche darzulegen, was mich nach
Auschwitz führt...
Gegen halb vier kommen wir in der Jugendherberge von Oswiecim
an.
Auschwitz – Oswiecim; ein polnisches Städtchen wie
jedes andere. Ich empfinde nichts außergewöhnliches.
Nach dem Einchecken um vier das erste Treffen in Kleingruppen
Councils oder Rundgespräche genannt.
Wir sitzen mit acht Personen im Kreis, stellen uns einander
vor, versuchen zu erklären, warum wir hier sind. Jüdinnen
aus Israel, jüdischstämmige Amerikanerinnen, ein Pole,
ein Deutscher, ein Schweizer.
Zum ersten Mal erzähle ich Juden von der tiefen Scham,
die ich empfinde im Angesicht der Verbrechen, die im deutschen
Namen begangen wurden. Und ich erzähle von der Trauer in
mir, der Traurigkeit, für die ich keine Worte habe, die
ich mit zunehmendem Alter immer deutlicher spüre, der ich
einen Raum geben möchte, die ich durchleben möchte,
loslassen möchte um Heilung, um Frieden zu finden.
Zum Abschluss dieser ersten Sitzung meditieren wir gemeinsam
und halten uns im Kreis die Hände. Es tut gut Evelins warme
vertrauensvolle Hand zu spüren. Evelin aus Israel, die
sagt, dass der Holocaust sie jeden Tag ihres Lebens begleitet...
Obwohl die Jugendherberge kaum 30 Gehminunten vom Vernichtungslager
entfernt liegt, trennen mich doch noch Welten von ihm, bin ich
noch nicht angekommen in dieser ersten Nacht in Auschwitz...
Morgen früh werden wir zu Auschwitz Eins starten, dem Gründungslager.
Dienstag:
Beim Frühstück sitze ich neben einer Frau. Wir hatten
uns bei der Registrierung am Sonntag im Saski Hotel die Hand
gedrückt. Ich war sehr beeindruckt. Zeitlos alt wirkte
sie auf mich. Ihr schneeweißes Haar fiel zu jeder Seite
in lang geflochtenen Zöpfen auf die Schultern. Ihr sonnengebräuntes,
wettergegerbtes Antlitz strahlte Anmut und Klarheit aus. Den
tiefen kastanienbraunen Augen entsprang ein starker Wille. Ich
blickte in ein gütiges Gesicht und empfand Scheu bei unserem
ersten Händedruck.
”Wo kommen Sie her?”, frage ich nach
einer schweigenden Weile.
Augenblicklich sah sie mich an und antwortete: ”Wieso
sprechen Sie Deutsch mit mir?”
Ja, wieso hatte ich sie auf Deutsch angesprochen? Im Zweifelsfall
sprach man Englisch, das war die gemeinsame Verständigungssprache
aller Teilnehmer. Warum sprach ich diese Frau auf Deutsch an,
ohne zu wissen wer sie war und woher sie kam?
Getroffen in dem Gefühl, mich daneben benommen zu haben,
sagte ich: ”If you like, we can talk in English.”
”Nein, jeder in seiner Sprache.”, erwiderte sie
”Ich heiße Christa-Rachel und komme aus Israel.”
Deutsch war ihre Muttersprache.
Die Unterhaltung dauerte nicht lang und mir blieb das Gefühl,
eine Ohrfeige bekommen zu haben.
Ich schließe mich der Gruppe an, die zu
Fuß zum Auschwitz Museum geht. Unterwegs sehe ich ein
Blechschild mit Werbung für Radio Maria. Ein Stück
weiter kläffen uns Schäferhunde hinter Gartenzäunen
an. Das Lager betreten wir von hinten und treffen uns vorn am
Informationszentrum mit den Anderen. Zwei Filme bekommen wir
gezeigt, die das Unfassbare dokumentieren, Zeitzeugnis ablegen.
Wir sehen Bilder von Überlebenden, die die Sieger nach
der Befreiung von Auschwitz fanden. Kinder, die ihre Namen nicht
mehr wissen, weil sie in Auschwitz nur das Recht auf eine Nummer
hatten und ein Recht zu leben, solange die Versuche an ihnen
dauerten, zum Nutzen deutscher Wissenschaft, deutschem Fortschritts
und deutscher Kultur.
Dann sehen wir Bilder von den Toten von nicht Überlebenden
der Nazikonzentrationslager. Ausgemergelte Skelette, lieblos
von verschlossenen Deutschen auf Karren geworfen und in Massengräbern
beerdigt; kontrolliert und dokumentiert von den Siegern.
Das Unfassbare so nah. Meine Gefühle setzen aus.
Benommen trete ich ins Freie.
Wir werden in zwei Gruppen geteilt, die mit jeweils einer Führung
das Lager besichtigen. Was kann man sagen, was kann man fühlen
im Angesicht der Haare von vierzigtausend vergasten, exemplarisch
hinter dicken Glasscheiben ausgestellt. Was können sie
erzählen von dem Leid. Ist das fassbar für menschliche
Gefühle?
Daneben die Vitrine mit den Produkten, die die deutsche Industrie
für das deutsche Volk daraus herstellte.
Exemplarisch ein Kinderessbesteck als letzte Habe eines Vernichteten.
Hilfe zu erfassen, was Menschen sich hier angetan. Dem Mensch
seine Menschlichkeit nehmen war Sinn und Zweck der Lager. Zum
Tier, zum Parasiten am Blute des reinen deutschen Volkes musste
man in machen. Die Scham, ein reiner Deutscher zu sein sitzt
tief in mir. Ich spüre sie beim Anblick dieses Kinderbesteckes.
Mein Glaube an allen Menschen gemeinsame Werte, mein Glaube
an die Aufklärung, an den Humanismus. Sie werden so vollkommen
in Frage gestellt beim Anblick dieser Kindergabel. Ich fühle
mich haltlos.
Der Kontakt mit den Wänden der Gaskammer.
Nur einige Hundert Menschen konnten hier gleichzeitig der Endlösung
zugeführt werden, gequetscht, dass sie selbst tot nicht
umfielen. Hier wurde nur geübt. Drüben in Auschwitz-Birkenau
war die Vernichtungstechnik weiter optimiert worden.
Am Ende der Führung treffen wir uns zu einer Zeremonie
im Hof des Gefängnisblockes vor der Erschießungsmauer.
Ich biete eine Kerze - ein lebendes Licht - zum Gedenken dar.
Mein Herz ist geschnürt, kaum fähig den Schmerz anzunehmen.
Wir nehmen unser Mittagsmahl in der Kantine des Museums ein.
Dann steigen wir in den Bus, um hinaus zum Lager Zwei nach Birkenau
zu fahren.
Wir betreten das Lager von der Seite. Fünf-, sechshundert
Meter entfernt vom Haupttor gehen wir den Weg von Gefangenen,
die das zweifelhafte Glück hatten, nicht sofort nach ihrer
Ankunft vergast zu werden. Gefangene, auf die die langsamen
Todesqualen des Arbeitslagers warteten. Doch zugleich war es
auch der Weg für alle, die im Vernichtungskomplex vier
und fünf ihr Ende fanden.
Rechts am Weg ein Foto, das eine jüdische Familie, Frauen
und Kinder, in dem Wald zeigt, auf den ich schaue. Es erweckt
den Eindruck von Alltag, von sich einrichten und warten auf
das was kommt. Es war einzig das Warten auf den Tod, wenn der
Andrang zu groß und die Gaskammer noch nicht geräumt
war für die nächsten zweitausend.
Links ein kleiner Teich. Dunkel in herbstlicher Stille. Ascheteich
lese ich. Hier hinein wurden die menschlichen Überreste
aus den Krematoriumsöfen gekippt.
Dann stehen wir vor den Ruinen des Krematorium vier, dem einzigen
Vernichtungskomplex, der durch Widerstand von Häftlingen
zerstört wurde. Es war das Sonderkommando für den
Betrieb der Anlage, die jüdischen Häftlinge, die die
Habe der Gemordeten aussortierten und abtransportierten, die
ineinandergekrampften Leichen aus der Gaskammer zogen, ihnen
die Haare schoren, das Gold aus den Kiefern brachen, sie in
die Verbrennungsöfen schoben, die Öfen reinigten und
versorgten. In regelmäßigen Abständen wurden
die Häftlinge dieser Sonderkommandos als Mitwisser selbst
vergast.
Ich blicke auf von der Gedenktafel zu dem nahen Wald. Birken
leuchten in goldenem, gelb und braun schattiertem Laub. Zwischen
ihnen das dunkle Grün in Gruppen oder einzeln stehender
Kiefern und darüber erstrahlt ein wundervoller Regenbogen
vor dem verdunkelten Himmel. Es ist windstill, nur ab und an
wirbelt eine sanfte Böe Laub vor sich her.
Tief atme ich die milde Luft ein. Solche Schönheit, so
viel Friedfertigkeit an einem so finsteren Ort. Fast unwirklich
empfinde ich in der Sonne stehend, die landschaftliche Schönheit
Birkenaus. Der Kontrast zu den Schrecken, denen ich begegne
ist zu scharf.
Wir begeben uns zur Sauna. So nannten die Nazis den Gebäudekomplex,
in dem frisch Eingetroffene zu Lagerhäftlingen gemacht
wurden.
Ausziehen, nackt stundenlang warten, stehend auf Betonböden.
Dann plötzlich getrieben durch Gänge, empfangen von
Häftlingssklaven, die hastig mit stumpfen Messern jegliche
Körperbehaarung entfernen. Lüsterne Blicke herrisch
stolzierender SS-Aufseher auf schutzlos entblößte,
verwundete Schöße.
Weitergetrieben zum Duschraum, stehen, warten, Ungewissheit.
Unvorbereitet eiskaltes oder brühend heißes Wasser
von der Decke, zwei, drei Minuten lang, ohne Möglichkeit
der Drangsal zu entkommen.
Wieder stehen, warten, erneut durch Flure getrieben, die Nummer
auf den Arm tätowiert, in Häftlingslumpen gesteckt,
warten, um schließlich hineingestoßen zu werden
in die Vernichtungsmaschinerie des Lagers.
Hinter Fenstern lächelt mich Birkenau im betörenden
Sonnenschein an, wärmt mir das Herz, das sich dem Schmerz
nicht öffnen kann.
Am Ende treffen wir uns alle in einem Raum, der eine Ausstellung
von Fotos zeigt. Letzte Andenken von Opfern, die auf wundersame
Weise erhalten blieben. Hochzeitsfotos, Familienfotos, Kinder.
Sie geben dem Tod Gesicht und Namen, zeugen von dem blühenden
Leben, das hier vernichtet wurde.
Einen Kreis bildend halten wir eine Gedenkzeremonie. Rabbi Ohad
geleitet uns einfühlsam mit seiner Gitarre. Wir singen
das Kaddish, eine jüdische Liturgie, deren Text wir in
verschiedenen Sprachen ausgehändigt bekamen. Ich singe
mit, fühle mich nicht abseits.
Vom Inneren des Lagers gehen wir nun zum Haupttor. Ein Gleis
führt dort hinein und spaltet sich auf in zwei Stränge.
Am Ende zu jeder Seite die Krematorien zwei und drei. Hundert
bis dreihundert Meter blieben den Opfern vom Ausstieg aus dem
Waggon bis sie für immer in den unterirdischen Räumen
der Anlage verschwanden. Fünf Verbrennungsöfen pro
Komplex, ein weiterer zum Beseitigen jeglicher Dokumente und
ein Letzter optimiert für das Einschmelzen des Zahngoldes.
Beschämt stehe ich vor der Gedenktafel der Krematoriumsruine.
Welchen Wert hat deutsche Gründlichkeit? Welchen Wert hat
meine Gründlichkeit?
Ich betrete das zentrale Mahnmal zwischen den beiden Krematorien
am Ende der Gleise, lese die Gedenktafeln in den Sprachen der
hier gemordeten. Tränen füllen meine Augen.
Es geht weiter im Programm...
Am Abend nach dem Essen gibt es ein Treffen im
Seminarhaus der Jugendherberge. Der einzige Raum des Gebäudes
reicht gerade aus, um uns alle zu fassen. Es herrscht ein dichte,
gespannte Atmosphäre angefüllt von den Erlebnissen
des Tages. Im Zentrum des Raumes acht Hocker, der Inner Circle.
Es gelten die gleichen Regeln wie in den kleinen Gruppen: Sprechen
vom Herzen, mit dem Herzen zuhören und Vertraulichkeit.
Wer reden möchte, setzt sich auf einen Platz im Inner Circle
und ergreift ein Talking Piece aus der Mitte. Nur eine Person
kann so ein Talking Piece halten und nur Sie hat das Wort, bis
sie den Gegenstand zurück in die Mitte legt.
Es ist schwieriger mein Herz dieser großen Gruppe zu öffnen.
Ich höre zu, bezeuge das Geschehen. Schließlich ergreift
Christa das Wort. Sie erzählt mit Vehemenz und Engagement.
Ihre Kraft und Entschlossenheit erfüllen den Raum. Ich
werde erregt, spüre wie mein Herz beginnt schneller zu
schlagen. Es ist nicht der Inhalt ihrer Wort, es ist ihre Vortragsweise,
die mein Herz ergreift. Ich empfinde das Deutsche, das Preußische
darin, empfinde mich selbst und die Art, wie ich meine Überzeugungen
verfochten habe. Ich sehe mich in Christa, spüre mich als
Betrachter von Außen, spüre, was Menschen meinen,
wenn noch so berechtigte Anliegen von mir in ihnen Angst und
Widerstand erzeugen. Immer heftiger beginnt mein Herz zu pochen.
Jahrzehnte war mein Engagement mit vom Hass getragen. Hass auf
die Täter, Hass auf den scheinheiligen Kirchenmenschen,
den gleichgültigen untertänigen Spießbürger.
Bitter hatte ich erfahren, wie die aus mir entspringende Gewalt
sich auch gegen mich selbst und das was ich liebe richteten.
Die Angst vor meinen deutschen Tugenden verbunden mit der Gewalt
in mir, ließen mein Herz rasen. Noch während Christa
spricht, setze ich mich auf einen frei gewordenen Platz im Innern.
Als ich das Talking Piece in meinen Händen halte, beginne
ich von meinem pochenden Herzen zu erzählen, von meiner
Angst, wenn sich Empörung und Handlungsbereitschaft mit
einem hasserfüllten statt einem friedvollen Herz verbinden.
Ich wollte nicht mehr hassen. Ich wollte verstehen, Versöhnung
finden.
Mittwoch
Schon vor dem Frühstück treffen wir uns im Council,
der kleinen Gesprächsrunde.
Nach dem Frühstück sitze ich auf meinem Bett und schaue
mir die Namenliste an, die ich heute Nachmittag verlesen werden.
Über hundert Namen, eng gedruckt auf einem Blatt. Jeder
von uns bekam eine Liste. Namen von Opfern, die hier ermordet
wurden. Namen, die von uns bei Meditationen verlesen werden.
Meine beginnen alle mit L. Ganze Familien sind aufgeführt,
selbst im KZ geborene Kinder. Die meisten sind deutsche Familiennamen.
Ich werde sie leicht verlesen können. Zwei polnische Nachnamen
erscheinen mir unaussprechbar und ich frage Michal, meinen polnischen
Zimmergenossen, nach der korrekten Aussprache, übe einige
Male. Dann mache ich mich auf den Weg mit denen, die zu Fuß
nach Birkenau gehen.
Das Wetter hat sich geändert. Es ist kälter geworden,
ohne Sonnenschein und es scheint mir passender für den
Ort, an den wir gehen. Der Weg führt durch Wohngebiete,
alte und neue. Dann geht es eine Verkehrsstraße entlang,
parallel zu den Gleisanlagen von Oswiecim. Schließlich
biegen wir ab von der großen Straße, queren die
Gleise über eine Brücke und lassen bald die letzten
Häuser hinter uns. Vor uns liegen Felder und der Blick
auf Birkenau. Gewaltig das Lager, das Eingangstor mit dem großen
Wachturm und dem hineinführenden Todesgleis. Mehr als hunderttausend
Gefangene, über anderthalb Millionen, die hier den Gastod
starben. Allgegenwärtig Abgrenzungen, Elektrozäune,
Todesdrohung. Ich kann die Bedrohlichkeit des Lagers noch immer
spüren.
Im Lädchen neben dem Toreingang erhalten wir Sitzkissen,
eine Isomatte und Plastiksäcke zum Schutz der Kissen gegen
Regen und Schmutz. Dann gehen wir hinein. Zwischen den Gleisenden
bilden wir einen großen Kreis, lassen uns nieder, dort
wo die Menschen bei ihrer Ankunft selektiert wurden entweder
für das Lager oder den sofortigen Tod. Bänke werden
herangeholt für alle, die schlecht sitzen können.
Im Zentrum des Kreises entsteht eine Art Altar zusammengefügt
aus herumliegenden Steinen und Hölzern, mit entzündeten
Kerzen und einer Schatulle, in die die verlesenen Namenlisten
gegeben werden.
Als alle sich eingerichtet haben bläst Rabbi Ohad das Schofar.
Laut klagend dringt der anhaltende Ton aus dem Widderhorn mir
bis ins Mark. Die erste Periode stiller Meditation hat begonnen.
Ich sitze mit gekreuzten Beinen, nehme Fühlung auf mit
dem Ort, betrachte die Steine vor mir, lausche dem Wind, Gesprächsfetzen
vorbeigehender Besucher.
Plötzlich krampft ein Muskel gerade oberhalb der Kniekehle.
Immer tiefer geht die Verkrampfung. Der Schmerz beansprucht
alle Aufmerksamkeit. Ich versuche den Muskel zu entspannen;
es gelingt mir nicht; überlege das Bein zu strecken. Nein,
ich möchte mich nicht bewegen. Dann löst sich der
Muskel ein wenig, verkrampft erneut, löst sich und geht
in periodisches Zucken über. Irgendwann entspannt er sich
ganz und gar. Ich spüre wie die Unterseite des Schenkels
langsam den Boden berührt. Jetzt ist es gut. Nichts wehrt
sich mehr Kontakt aufzunehmen mit diesem Ort.
Auf ein Zeichen erheben sich vier Personen gleichmäßig
verteilt im Kreis und beginnen die Namen von ihrer Liste zu
sprechen. Jeder in seinem Ton, seinem Rhythmus, auf seine Art.
Endet ein Sprecher, geht er zur Mitte, legt seine Liste in das
Kästchen und verneigt sich. An seiner Stelle erhebt sich
der Nächste und beginnt zu lesen. Um mich herum ist der
Raum erfüllt vom Klang der Namen. Bewegt bezeuge ich die
Ehrerbietung und Demut, mit der Männer und Frauen, Junge
und Alte sich niederknien, beugen vor den Opfern, bis ihre Stirn
die steinige Erde berührt. Tränen rinnen meine Wangen
herunter.
Der letzte Name verhallt, die letzte Verbeugung. Wir sitzen
wieder in Stille.
Kurze aufeinander folgende Töne aus dem Widderhorn beenden
die Meditation.
Religious Services -Gottesdienste- an verschiedenen Stellen
im Lager sind angesagt. Jeder kann wählen, ein jüdischer,
ein christlicher und ein buddhistischer Priester stehen bereit.
Unentschlossen sehe ich mich um. Ich habe keine Heimat im Glauben,
weiß mich nirgendwo hinzuwenden.
Noch bevor ich mich für irgend etwas entscheide kündigt
eine grauhaarige Dame an, dass sie hier an Ort und Stelle Lieder
singen möchte und lädt jeden, der Lust hat, dazu ein.
Sie heißt Renate, lebt schon lange auf Hawaii, stammt
jedoch aus Berlin. Zu viert finden wir uns ein beim Singen.
Die Lieder handeln von Frieden, Liebe, Glaube, Gott. Sie gefallen
mir, aber ich schäme mich ein wenig für meine schwache
Singkunst. Dann spielt Maja aus der Schweiz auf einer indianischen
Flöte für uns. Die Klänge erfüllen mich
tief, lassen mich Frieden und irdene Verbundenheit empfinden.
Zur Mittagspause wartet ein Suppenwagen vor dem
Lagertor. Jeder erhält eine Plastikschüssel, ein Stück
Brot. Die heiße, wohlschmeckende Flüssigkeit tut
gut. Es fällt nicht schwer, sie an diesem Ort gebührend
zu würdigen.
Nach der Pause versammeln wir uns erneut zwischen den Gleisen
um zu meditieren. Meine Liste in den Händen haltend stehe
ich unentschlossen in dem Kreis aus Kissen und Bänken.
Jetzt ist es auch an mir, Namen zu lesen. Wohin setze ich mich?
In diesem Moment kommt eine kleine alte Frau auf mich zu. Es
ist Janina, Christas Freundin. Fast immer sehe ich sie zusammen.
Sehr zurückhaltend irgendwie ängstlich wirkt sie auf
mich. Ich muss mich zu ihr hinunter beugen, um zu verstehen,
was sie möchte. Ihr Interesse gilt meiner Liste, den Namen,
die darauf stehen. Ich frage, wonach sie sucht, nehme naiv an,
dass sie vielleicht Namen an passender Stelle ergänzen
möchte. Gerne würde ich ihr das anbieten. Aber ihre
Reaktion ist abwehrend. L war nicht der Buchstabe, nach dem
sie sucht. Schnell wendet sie sich ab, dem Nächsten zu
mit einer Liste in der Hand.
Noch immer unschlüssig sehe ich um mich und erblicke Ruth
aus meiner Council Group. Sie hat mein Alter. Ihr Vater war
Holocaust Überlebender und Mitbegründer des Staates
Israel. Wir mögen uns. Auch sie und ihr Mann werden jetzt
Namen lesen. Gemeinsam setzen wir uns auf eine Bank.
Mein ängstliches Gefühl wird gemildert durch Ruth
an meiner Seite.
Angst? Wovor?
Ich, Enkel eines Nazi, der noch vor ‘33
in die NSDAP eintrat, der als Soldat in russischen Gefangenenlagern
tätig war. Welcher Verbrechen hatte er sich schuldig gemacht?
War er mehr gewesen als nur ein opportunistischer Mitläufer?
Trotzdem hatte ich ihn gemocht, liebte ich meinen Opa.
Es ist die Angst vor Ablehnung. Angst, meine öffentliche
Bitte um Vergebung für das, was Meinesgleichen Anderen
angetan, könnte Misslingen.
Die Meditation beginnt ...
Ze‘ev, Ruths Mann, verließt als Erster
Namen, legt sie in die Schatulle, verbeugt sich. Ruth folgt
ihm. Dann bin ich dran.
Ich stehe auf, nehme die Liste und beginne laut zu lesen.
”Adam Lange, Hans Lange, Ismael Lange, Magda Lange, Salomon
Lange, Simon Lange, Klara Langenfeld ...”
Schnelle verfalle ich in einen gleichmäßigen Rhythmus,
spreche bewusst den Vornamen zuerst, obwohl die Liste mit dem
Familiennamen beginnt. Es überrascht mich, wie weich, wie
warm meine Stimme klingt. Eine Zärtlichkeit schwingt darin,
die ich sehr selten spüre. Ihr seid genug angeschrien worden,
genug gebrülltes, geiferndes Deutsch, möchte ich ihnen
sagen, lese und lese. Alle möchte ich sie nennen, alle,
die hier zu Namenlosen, zu Ausgelöschten werden sollten.
”... Anna Liebekind, Jakob Liebekind, Samuel Lindemann,
...”
Schließlich bin ich am Ende. Langsam schreite
ich in den Kreis, falte den Zettel und lege ihn in das Kästchen.
Dann trete ich einen Schritt zurück, knie mich nieder und
verbeuge mich bis zum Boden. Nehmt meine Entschuldigung an,
meine tiefe, tiefe Trauer.
Als ich wieder auf der Bank sitze, ist die Nervosität abgefallen.
Ruhig folge ich dem Verlauf der Zeremonie bis an ihr Ende...
Wir packen unsere Sachen, um mit dem Bus oder
zu Fuß zur Jugendherberge zurück zu kehren. Den Plastiksack
mit Isomatte und Kissen geschultert wende ich mich zum Gehen.
Erschöpft, ein wenig durchfroren mache ich mich auf den
Weg in Richtung Tor. Jemand zupft mich am Ärmel. Janina!
Wieder beuge ich mich zu ihr hinunter, um besser zu verstehen.
”Ich möchte dir sagen, dass ich es sehr schön
fand, wie du die Namen gelesen hast. Es tat so gut, jüdische
Namen mit so viel Ehrfurcht, so respektvoll auf deutsch gesprochen
zu hören.”
Mir schießen Tränen in die Augen.
”Ich wollte auf diese Weise sprechen; auf Deutsch.”,
stammele ich, ihr in die Augen blickend. Dann lässt mich
Janina allein. Es gibt nichts, was wir uns mehr mitteilen können
in diesem Augenblick.
Meine Bitte um Vergebung war angenommen worden.
Diese Frau, mit der ich keine drei Sätze gesprochen hatte,
deren Schicksal ich nicht kannte, nur erahnte hatte mir vergeben.
Vergeben für etwas, was ich nie begangen habe. Ich kann
nicht beschreiben, wie erleichtert, wie beglückt, wie reich
beschenkt Janinas Worte mich machten. Es war mehr als ich ertragen
konnte und ich war froh allein meinen Weg zur Jugendherberge
fortzusetzen. Dieses Empfinden konnte ich niemandem mitteilen,
nicht jetzt. Alles was ich hasste am Deutsch sein, an meinem
Deutsch sein, was so unversöhnlich in mir war. Es fand
einen Weg zu heilen.
Immer neue Gefühlswellen verbunden mit heißen Tränen
wallen auf, während ich das Lager, Birkenau und die Felder
hinter mir lasse. Auf Höhe der ersten Häuser werde
ich von Christa eingeholt. Sie gesellt sich an meine Seite.
Offensichtlich möchte sie mit mir sprechen.
”Gerade hat mir deine Freundin das schönste Geschenk
meines Lebens gemacht.”, beginne ich die Unterhaltung
Christa befragt mich, möchte wissen, wer ich bin, was ich
tue. Ich erzähle von meiner Herkunft, meiner andauernden
Suche nach Sinn, meiner Aufgabe in diesem Dasein, der Suche
in Büchern, in der Wissenschaft, im politischen Engagement;
erzähle von meiner kleinen Tochter, meiner Hausmannzeit...
Es wäre meine Fähigkeit zu weinen, die mir die Richtung
weist, wo ich meine Aufgabe finden mag, sagt Christa.
Ich zucke mit den Schultern. Was weiß ich. In diesem Moment
habe ich keine Vorstellung von der Zukunft, spüre nur,
dass Janinas Worte etwas verändert haben in mir, dass eine
Tür aufgestoßen, ein verschlossener Raum betretbar
wurde, dass Licht auf etwas fiel, was meine Furcht bislang verbarg.
Christa erzählt von Janina, die den Holocaust als Kind
in Polen überlebte, immer auf der Flucht, in ständiger
Angst, für die jeder Deutsche, allein das hören Deutscher
Sprache mit tödlicher Bedrohung verbunden war.
Und sie erzählte von sich, ihrer ersten großen Liebe
als junges Mädchen nach dem Krieg. Er hieß Rüdiger,
genau wie ich. Ausgerechnet durch ihn erfuhr sie bitter die
hässliche Fratze des deutschen Antisemitismus verbunden
mit elitärem Dünkel. Vielleicht hatte dieser Rüdiger
seinen Einfluss auf unsere ersten Begegnungen gehabt...
Unser Gespräch endet erst als wir die Jugendherberge erreichen.
Nur kurz gehe ich auf mein Zimmer. Es ist noch fast eine Stunde
bis zum Abendbrot. Aber ich kann nicht sitzen, nicht liegen,
muss raus, allein, für mich sein.
Als ich ein Wäldchen am Fluss hinter der Jugendherberge
erreiche, fühle ich mich unbeobachtet, geborgen vom Schutz
der Bäume. Weinkrämpfe brechen aus mir hervor, tiefes
hemmungsloses Schluchzen, immer von neuem, sobald ich mich etwas
erholt habe. Was beweine ich? Welcher Damm in mir ist aufgebrochen?
Was habe ich so lange aufgestaut, zurückgehalten?
Mir fehlen die Worte. Die Antwort scheint jenseits meines Sätze
bildenden Verstandes. Es tut so gut diese Tränen zu weinen.
Es ist so befreiend dieses Loch im Damm zu spüren. Hin
und her laufe ich im Wald, auf Wegen am Fluss entlang in der
heraufgezogenen Dunkelheit, sauge tief die kühle Luft in
mich ein. Schließlich verebben die Tränen und ich
komme rechtzeitig zum Abendbrot.
Für das Abendprogramm steigen wir alle in
den Bus, der uns zu einem Franziskaner Kloster bringt. Dort
werden wir in den Keller einer alten Kirche geführt. Das
Gewölbe beherbergt eine Bilderausstellung, ”Labyrinth”
von Marian Kolodziej. Es ist das Zeugnis eines Überlebenden,
der vom Anfang bis zum Schluss in Auschwitz war, Häftling
Nummer 432 als polnischer Widerständler mit nicht einmal
elf Jahren eingeliefert.
Fünfundfünfzig Jahre nach den Ereignissen und nach
einem Schlaganfall, schloss sich Marian noch einmal für
ein Jahr freiwillig in das Lager, erfüllte mit seinen Zeichnungen
die Verpflichtung, das den Kameraden gegebene Versprechen, der
Menschheit zu berichten, wie es dort war.
Marian selbst ist anwesend mit seiner Frau. Er gibt uns einige
einleitende Worte. Nicht als Kunst - wir sind auf keiner Vernissage
- als ”Worte, die in einer Zeichnung verschlossen sind”,
als ”Detailfotografien” ”wie ein Fotograf”
in Auschwitz möchte er seine Bilder verstanden wissen.
Ich kann das Dargestellte nicht beschreiben. Es ist eine offene
Wunde des 20. Jahrhunderts, die hier vor mir blutet, ein nicht
endender verzweifelter Schrei. Der zeitlose Schrei des Grauens,
die Hölle unseres Daseins...
Ich fühle Marians Schreien, es ist der Schrei in mir.
Viel zu schnell verrinnt die Zeit. Noch bevor
ich alle Bilder betrachtet habe, treffen wir uns im hintersten
Teil des Gewölbes, wo Bänke aufgestellt sind und Marian
auf uns wartet.
Seine Frau verließt eine Ansprache, denn es ist für
Marian zu beschwerlich laut für längere Zeit englisch
Vorzutragen. Wir lauschen gebannt, hören von der Entstehung
der Bilder, dem Schlaganfall, dem Zeichnen, das zum Überlebenskampf
wurde. Hören von den konkreten Geschehnissen, den erlebten
Details, die einzelnen seiner Zeichnungen zugrunde liegen. Hören
auch von dem, was ihn am Leben hielt in dieser Hölle.
Moslems wurden die genannt, die es nicht mehr vermochten ihr
Innerstes zu bewahren, ihr NEIN zu der Entmenschlichung, deren
Widerstand von Hunger, Entkräftung, den ständigen
Qualen endgültig gebrochen war. Die Augen stumpf, apathisch,
gleichgültig geworden. Moslems hatten keine Chance das
Lager zu überleben. Unweigerlich kommt mir der Israelisch-Palästinensische
Konflikt in den Sinn.
Die Runde ist offen für Fragen an Marian.
Jemand erzählt von dem Regenbogen, den wir am Vortag gesehen
haben, möchte wissen, ob es solche Momente, Momente natürlicher
Schönheit für Lagerinsassen gab. Über dem Himmel
von Auschwitz lag der immerwährende, beißende Krematoriumsrauch,
der selbst die Sonne verdeckte. Es gab einen kleinen Baum auf
dem Lagergelände. Nie trug er ein einziges grünes
Blatt. Sie wurden von den Häftlingen sofort gegessen.
Trotz der Hölle, über die wir reden,
strahlt Marian Wärme, ja Freude aus. Rührend ist der
Umgang zwischen ihm und seiner wundervollen Frau, ja selbst
zum Lachen bringt er uns mit seinen Witzeleien.
Und doch am Ende gefragt nach seinem Ausblick gibt er sich pessimistisch,
sieht, ”dass sich nach Auschwitz auf der Erde nichts geändert
hat, - und es hatte sich etwas ändern sollen -, nein, es
ist schlimmer geworden. Die Welt wird weiterhin vom Lagerrecht
beherrscht. Die Todesfabriken sind modernisiert und auf Computer
umgestellt worden. Die abscheuliche Apokalypse aus meinen Zeichnungen
dauert fort.”
”Was für ein Sinn? Warum?”, richtet er seine
abschließende Frage an uns.
Stille erfüllt den Raum.
Daniel, ein junger, einfühlsamer New Yorker, versucht eine
Antwort:
”May be you are a part of the answer and that we are here
with you...”
Am Ende kaufe ich einen Bildband von Marians Labyrinth. Das
schwere Buch in den Händen steige ich die Treppen hinauf
ins Freie.
Auf dem Vorplatz bekomme ich mit, dass Laura, eine junge Amerikanerin,
mit Andre bespricht, wie sie die Nacht in Birkenau verbringen
möchte. Sofort bekunde ich mein Interesse mitzukommen.
Unabhängig von den Organisatoren hatte ich geplant eine
Nacht allein ins Lager zu gehen und dort zu meditieren. Dieser
Wunsch entstand in mir lang bevor ich mich für Auschwitz
angemeldet hatte. Eigens dafür hatte ich ein Grablicht
mitgebracht.
Obwohl Laura direkt von hier mit einem PKW am Lager abgesetzt
werden sollte, arrangiert Andre, der federführende Organisator
von polnischer Seite, dass unser polnischer Chauffeur mit Laura
vor der Jugendherberge auf mich wartet bis ich mein Rüstzeug
für die Nacht zusammengesucht habe.
Fast stürme ich aus dem Bus auf mein Zimmer und stopfe
in Windeseile alles, was ich benötige, in meinen Rucksack.
Draußen auf dem Parkplatz wartet der Wagen und einige
Leute, die uns verabschieden. Elisabeth, der ich auf der Rückfahrt
im Bus von meinem Vorhaben erzählte, überreicht mir
eine Thermohose von ihrem Sohn.
”Damit hat er schon Übernachtungen auf 4000 Meter
überstanden.”
”Danke...”
Alles ist verstaut. Wir steigen ein. Der Wagen fährt los.
Kurze Zeit später halten wir vor dem Lagertor und laden
unsere Sachen aus. Unser Begleiter geht mit uns zur Wachmannschaft,
die unten im Wachturm ihr Quartier hat. Er meldet uns an und
sagt, dass wir in der Kinderbaracke übernachten wollen.
Dann ist alles geregelt. Wir bedanken uns bei unserem Fahrer.
Ein kurzer Abschied und der Wagen verschwindet in der Nacht.
Laura und ich sind allein.
Wir ordnen das Gepäck nochmals, um es besser tragen zu
können und laufen los. Zunächst geht es den äußeren
Elektrozaun entlang und dann durch einen Nebeneingang. Laura
folgend betrete ich diesen Teil des Lagers zum ersten Mal. Die
Baracken sind hier alle erhalten geblieben. In Längs- und
Querreihen stehend unterscheiden sie sich nicht voneinander.
Schwarze Klötze in der Dunkelheit. Aber wir finden unseren
Weg. Laura hatte sich den Platz am Tage ausgesucht.
Die Kinderbaracke! Der Eingang steht völlig offen, denn
es fehlt die Tür. Behutsam treten wir ein. Es ist sehr
dunkel im Innern. Laura entzündet Kerzen. Mit ihnen nehmen
wir die Baracke in Augenschein.
An die Wände des Eingangsbereiches sind Bilder gemalt.
Sie erinnern an Zeichnungen aus alten Kinderbüchern. Auf
der einen Seite ein Kind, das freudig zur Schule geht, auf der
Anderen Kinder mit Spielzeug, einem Steckenpferd, einer Trommel...
Gemalt für Kinder, die jeden Tag dem Tod ins Auge blickten,
die nichts von alledem mehr hatten. Ich empfinde den verzweifelten
Versuch, ihnen einen Rest von Hoffnung, etwas Kindgerechtes,
etwas Menschliches zu geben in diesen Bildern.
Zwei lange Gänge führen durch die Baracke. Zu beiden
Seiten jedes Ganges in mehreren Etagen Bunker, etwa 1,70 Meter
tiefe und 2 Meter breite Parzellen, mit gemauerten Seiten und
Böden aus groben Holzbohlen. Hierin lebten und schliefen
sie; zu fünft, zu sechst, zu zehnt?
Laura wählt einen Bunker nahe dem Eingangsbereich bei den
Bildern für ihr Gepäck. Dort will sie ruhen, den Rest
der Nacht verbringen, wenn sie meditiert, ihre Zeremonien vollendet
hat. Ich gehe tiefer hinein in die Baracke, suche mir einen
weit entfernten Bunker im selben Gang. Wir wollen uns nicht
stören in unserem allein sein. Im Schein einer Kerze ziehe
ich alle mitgebrachten Kleidungsstücke an. Es ist um den
Gefrierpunkt und wird im Verlauf der Nacht noch kälter
werden. Als ich fertig bin entzünde ich meine mitgebrachte
Kerze. Dann schultere ich den Plastiksack mit Kissen und Matte,
nehme die Kerze und gehe wieder nach vorn zu Laura. Sie will
hier meditieren an Ort und Stelle bei den Kindern, mit ihnen
sein.
”Ich gehe jetzt zum Krematorium und werde mich dort hinsetzen.
In zwei, drei Stunden werde ich wieder hier sein. Bis später.”
Laura verabschiedet mich und ich trete ins Freie. Der Mond schaut
zwischen den Wolken hervor. Langsam streiche ich zwischen den
Baracken und suche meinen Weg zur Selektionsrampe. Bald stoße
ich auf einen Zaun, treffe auf einen Weg, von dem mir meine
Orientierung sagt, dass er zu den Gleisen führt. Bevor
ich weitergehe beleuchte ich mit meiner Kerze das Schild, das
am Eingang zu dem Lagerteil steht, aus dem ich gerade komme.
Es ist das Frauenlager. Beim Lesen strahlt mit einemmal helles
Licht hinter mir auf. Als ich mich wende werde ich von zwei
grellen Scheinwerfern geblendet. In der Ferne mache ich ein
Auto aus. Es ist der Wachdienst auf seiner Kontrollrunde. Sie
haben mich entdeckt und ins Visier genommen. Ich fühle
mich gestört, erwarte, dass sie jetzt kommen, mich kontrollieren,
ich mich rechtfertigen muss. Aber sie kommen nicht näher,
drehen ab und verschwinden.
Ich setze meinen Weg fort und erreiche die Selektionsrampe bei
der SS Baracke. Ein Foto ist dort auf einer Gedenktafel zu sehen.
Es zeigt Juden eben an dieser Stelle stehend mit einem SS-Mann,
der sie durch Daumenbewegungen auswählt - rechts Vergasung,
links Lager.
Mein Blick wandert umher. Ich stelle mir vor, wie die verängstigten
Menschen hier aus den Waggons entladen wurden, in grellem Scheinwerferlicht,
Sirenengeheul, brüllende SS-Mannschaften, wütend kläffende
Schäferhunde, angetrieben, auseinandergerissen, selektiert
für Tod oder Lager, noch bevor sie begreifen können
was geschieht...
Langsam gehe ich den Weg jener, die in die Gaskammer geschickt
wurden, gehe ihren letzten Gang. Am Ende der Rampe wird es finster.
Nur einige am Tage aufgestellte Kerzen brennen noch am zentralen
Mahnmal. Ich schreite durch das Tor, durch das sie alle mussten,
gehe die letzten Meter und stehe vor dem Eingang. Diese Treppe
mussten sie hinab und kamen nie wieder. Hier, genau hier, vor
diesen Stufen lasse ich mich nieder, lege die Matte auf den
Boden, das Kissen darauf, stelle die Kerze auf die erste Treppenstufe,
verbeuge mich und nehme Platz. Lasst mich mit euch sein. Ich
möchte bei euch sein, so nahe ich kann.
Wütendes Hundegebell außerhalb des Lagers dringt
von verschiedenen Seiten auf mich ein. Plötzlich höre
ich laut und deutlich die Geräusche eines Zuges. Es ist
keine Einbildung. Er rollt auf den nahen Gleisanlagen von Oswiecim,
dort wo der Marsch ins Lager begann, bevor es seine eigene Trasse
bekam.
Der Zug rollt vorüber. Auch die Hunde verstummen irgendwann.
Ich sitze....
Da raschelt es hinter mir. Ich zucke zusammen. Ein Schauer fährt
mir über den Rücken. Der Gedanke von Angreifern hinterrücks
formt sich. Doch ich widerstehe dem Impuls mich umzudrehen,
bewege mich nicht. Kein weiteres Geräusch folgt und ich
beruhige mich wieder,
sitze...,
schaue die Kerze, die hinabführende Treppe, die schwarze
Kellerruine.
Keine Gedanken, keine auftauchenden Bilder,
ich sitze...,
Frieden...
Ich weiß nicht, wie lange ich saß.
Schließlich verbeuge ich mich, lasse für Minuten
meine Stirn auf dem Treppenabsatz ruhen. Dann nehme ich die
Kerze, trage sie hinunter und stelle sie inmitten der Ruine
auf. Oben sammele ich meine Sachen, verbeuge mich ein letztes
Mal und gehe...
Dieses Mal nehme ich den Weg durch die Wiese, möchte die
Ruine als Ganzes umrunden. Es ist sehr finster ohne die Kerze.
Nur mühsam schälen meine Augen Formen aus der Nacht.
Erkennbar Bäume in einiger Entfernung und da die Gaskammer.
Ihr Anblick trifft mich unvorbereitet. Mir war nicht klar, dass
auch ihr Fundament erhalten war. Langsam schreite ich um sie
herum. Als ich sie fast umrundet habe, halte ich inne, schaue.
Noch einmal berührt mich das Grauen, fahre ich erschrocken
in eisigem Schauer zusammen. Was war?
Der Schreck geht vorüber. Ich fühle mich ruhig, sicher,
beschützt. Einmal werde ich wiederkommen und hier sitzen,
hier in den Ruinen der Gaskammer, so nahe bei euch, wie ich
nur kann in eurem letzten Augenblick...
”Hello? Rudi?”, fragt Laura als ich
die Kinderbaracke betrete.
”Yes.”
Sie hat einige Kerzen auf dem Boden brennen lassen, so dass
ich mühelos zu ihrem Schlafplatz finde.
”Wie geht es dir?”
”Es ist kalt.”
”Ja”, antworte ich, ”hast du schon geschlafen?”
”Nein, nur so vor mich hin gedöst. Ich konnte nicht
schlafen. Hast du auch die Hunde gehört und die Züge?”
”Ja. Ich werde mir jetzt meine Koje bereiten.”
”Wenn du magst, kannst du auch näher kommen. Du musst
nicht da hinten bleiben.”
Ich hatte nichts dagegen. Wir waren allein genug. Lauras Nähe
würde mir angenehm sein.
”O.K. Was hältst du davon, wenn ich mich hier hinlege?”,
sage ich und deute auf einen Bunker ihrem schräg gegenüber.
”Fein. Ich kann dir eine Taschenlampe geben, warte.”
Bald habe ich mich eingerichtet. Die dünne,
zu kurze Isomatte untergeschoben, mit einem zusätzlichen
Wolltuch von Laura bedeckt liege ich quer auf den Holzbrettern.
Mein Kopf ruht auf dem Sitzkissen. Hinter mir sehe ich ein Stück
vom Himmel durch ein winziges Fenster in der Barackenwand. Mattes
Mondlicht fällt dann und wann herein. Müde schließe
ich die Augen ohne Schlaf zu finden. Einen Schlafsack habe ich
nicht, bin aber in vier Paar Hosen und noch mehr wärmende
Schichten Oberbekleidung gepackt. Zwei Paar Socken und dicke
Wanderschuhe schützen meine Füße. Trotzdem werden
sie nicht warm und die Kälte kriecht mir stetig weiter
in die Knochen.
Immer wieder muss ich an die Kinder denken, die hier in weitaus
kälteren Nächten, ohne High Tech Kleidung, hungernd
und ohne Hoffnung lagen. Bilder ihrer erfrorenen Füße,
der amputierten Gliedmaßen aus dem Einführungsfilm
steigen auf in mir. Bei euch Kindern möchte ich sein mit
meinen Gedanken, ,jetzt, hier und bei dem kleinen, verlassenen,
ängstlichen Kind in mir. Es macht mir nichts, dass ich
unbequem liege und friere.
Irgendwo zwischen wachen und dösen vergeht
die Zeit. Ein-, zweimal wechsele ich einige Worte mit Laura,
die auch nicht schläft. Dann ist die Nacht vorbei. Gegen
fünf bin ich so durchgefroren, dass es mich heim zieht.
Gemeinsam mit Laura mache ich mich auf den Weg zur Jugendherberge.
Noch im Dunkeln verlassen wir das Lager.
In der heraufziehenden Morgendämmerung finden
wir unseren Weg. Dabei wird uns schnell wärmer mit all
den angezogenen Klamotten und eine rege Unterhaltung entspannt
sich. Völlig vertieft merke ich erst nach einer Weile,
dass wir einen Abzweig verpasst haben und umkehren müssen.
Als wir schließlich ankommen verbleibt nur wenig Zeit
bis um sieben die Gespräche in den Kleingruppen beginnen.
Donnerstag:
Nach der Gesprächsrunde und dem Frühstück geht
es erneut zum Lager. Das Wetter ist ungemütlicher geworden.
Ein kalter Wind weht und während wir an der Selektionsrampe
sitzen beginnt es zu regnen. Ich fühle mich im Einklang
mit dem Ort, mit dem Wetter, lausche dem Verlesen der Namen...
Dieses Mal entscheide ich mich nach der Meditation für
den christlichen Gottesdienst mit Vater Manfred. Wir folgen
ihm auf einigen Stationen des Kreuzweges, den die örtliche
polnische Gemeinde zum Gedenken durch das Lager nimmt.
Als wir am Krematorium III vorübergehen sehe ich meine
Kerze. Sie brennt noch immer...
Vater Manfred führt uns zu einem entfernten Teil des Lagerkomplexes
außerhalb der Sicherungsanlagen. Bei den Ruinen eines
ehemaligen Bauernhauses halten wir an. Vor uns liegt ein weites
Feld umsäumt vom herbstlichen Wald. Hier hatten die Nazis
ihre Vergasungstechnik erprobt. Vater Manfred weist auf die
Fundamente von zwei Baracken dreißig, vierzig Meter entfernt.
Dort mussten die Opfer sich entkleiden. Nackt wurden sie in
das Haus getrieben, rauchende Feuer aus offenen Gruben vor Augen.
Das Haus war ihre Gaskammer und in den Gruben auf dem Feld wurden
sie verbrannt.
Wieder will das grauenhafte Geschehen so gar nicht zu der empfundenen
Schönheit, ja der Friedlichkeit dieses Ortes passen.
Vater Manfred hält mit uns eine Andacht, betet, gedenkt
der Opfer. Dann ziehen wir weiter zur nächsten Station
des Kreuzweges.
Ich folge nur langsam, falle zurück, drehe mich noch einmal
um. Meine Augen wandern über das Aschefeld und einen Moment
lang sehe ich meine Tochter mit einem bunten Drachen über
die Wiese laufen. Lachend voll ausgelassener, kindlicher Freude
läuft sie. Ja, es ist gut für meine Kinder, dass ich
hier bin...
Ich wende mich und beschleunige meinen Schritt.
Am Nachmittag hat sich das Wetter weiter verschlechtert.
Im Regenponcho bereite ich mich auf das Sitzen vor. Doch dann
wird entschieden, dass wir alle in die Kinderbaracke gehen.
Eng gedrängt lassen wir uns im Schein von Kerzen bei den
Wandbildern nieder.
Jemand schlägt vor den Kindern Wiegenlieder zu singen.
Ihr Erklingen in jüdischer, polnischer, englischer Sprache
rührt mich. Zugleich macht es mich traurig und beschämt,
dass mir kein Liedchen für sie einfällt. Wer sang
mir jemals Wiegenlieder?
Schließlich stimmt doch jemand ein deutsches Liedchen
an und auch ich singe: ”Weißt du wie viel Sternlein
stehen...”
Zum Abschluss werden Kerzen von jenen entzündet, die damit
der Opfer gedenken wollen, die ihnen persönlich nahe standen,
die sie kannten und sei es auch nur aus Erzählungen...
Dann verkündet Amelie, dass sie jetzt gemeinsam mit Rabbi
Ohad oben im Wachturm des Eingangstores eine Zeremonie, die
der Täter gedenkt, abhalten wird. Jeder ist dazu eingeladen.
Ich bewundere Amelies Mut und Tatkraft. Aber noch fühle
ich mich nicht bereit zu so viel Nähe mit den Tätern...
Lieber nehme ich den Bus zurück zur Herberge und nutze
die Zeit bis zum Essen um zu ruhen.
Nach dem Abendbrot fahren wir erneut nach Birkenau
und versammeln uns unweit vom Eingangstor in einer der wenigen
erhaltenen Baracken des Männerlagers. Fensterlos ohne die
mehrstöckigen Pritschen, auf denen die Gefangenen lagen,
gleicht sie einem Pferdestall. In ihrer Mitte ist sie auf ganzer
Länge von einer Halbmeter hohen und breiten Backsteinmauer
durchzogen. Auf Kissen oder Bänken sitzend bilden wir einen
Kreis. Nahe der Wand spüre ich die Zugluft im Rücken.
Eine lange Reihe entzündeter Kerzen steht auf der Mauer.
Doch ihr Schein erleuchtet die Gesichter an der Wand gegenüber
nur schwach.
Wir sind zusammengekommen, um von unseren Erfahrungen zu berichten,
das mitzuteilen, was wir teilen möchten mit allen Anwesenden.
Andre eröffnet die Runde. Er erzählt uns von schönen,
tröstenden Erlebnissen beim Tode seiner Mutter und seiner
Schwiegermutter. Dann berichtet eine Frau wie sie als kleines
Mädchen versteckt von katholischen Nonnen in einem polnischen
Kloster den Holocaust überlebte. Verschiedene Teilnehmer
sprechen von ihrem Schmerz und mehr noch von der Hoffnung, der
heilenden Kraft, die sie hier in Auschwitz-Birkenau erfahren.
Ich fühle mich ermutigt auch meine Erfahrung zu teilen,
erzähle von der vergangenen Nacht und von dem Kind mit
dem Drachen, das ich über das Aschefeld laufen sah. Dies
ist nicht mehr allein ein Ort des Schreckens und des Horrors.
Ganz deutlich erfahre ich seine Kraft zu heilen...
Dann meldet sich Mark zu Wort. Er und Daniel reisen zusammen.
Zwei New Yorker Juden; jung, gut aussehend, intelligent, hervorragend
ausgebildet, selbstbewusst, mit klarem, kritischem Verstand
und warmen Herzen; das Beste was Amerika zu bieten hat. Wir
hatten noch keinen direkten Kontakt und ich fühle mich
unsicher im Umgang mit ihnen, besonders mit Mark. Ist es Neid?
Worauf?
Mark hinterfragt die aufgekommene Behaglichkeit, den Einklang
schönen Erlebens. Es stört ihn, dass die Welt von
heute, der Konflikt im Nahen Osten, das Morden hier und jetzt
ganz ohne jede Erwähnung bleibt. Wo ist der Bezug zum aktuellen
Geschehen und dem was wir tun sollten, können, müssen?
Nur zu gut kann ich sein Anliegen verstehen. Es gibt einen Teil
in mir, der genau so fragt. Und der Fragende in mir konstruiert
einen Gegensatz:
“Was ergehst Du Dich hier in ‚heiligen‘ Gefühlen
statt zu wirken da draußen, wo es nötig ist?”
Hätte Mark vor mir gesprochen, dann hätte ich mich
nicht mehr mitgeteilt. Zu banal, zu unwichtig, zu kitschig wäre
es mir vorgekommen. Selbst jetzt im Nachhinein fühle ich
mich nicht mehr ganz wohl mit meinem Beitrag, habe Zweifel am
‚Nutzen‘ für die Anderen und mich. Aber gerade
deshalb bin ich hier, um mein Herz zu öffnen, verbunden
zu sein mit meinem Schmerz, meinen Gefühlen auch wenn ich
nicht den praktischen ‘Nutzen‘ zu nennen vermag,
keine Antworten auf die heutigen Konflikte finde.
Bald nach Marks Beitrag ist die Runde beendet. Der Bus steht
bereit, um uns zurück zu bringen. Wer mag kann noch bleiben
bis Mitternacht. Mich hält es nicht mehr.
Wieder in der Jugendherberge kaufe ich mir im
Aufenthaltsbereich ein Flasche Bier und setze mich an einen
der aufgestellten Tische. Feierabend! Es geht mir gut und ich
bin in Plauderstimmung trotz der verspürten Müdigkeit.
Es ist vollbracht. Ich hatte das getan, weshalb ich gekommen
war. Gelassen sehe ich dem letzten Tag unseres Beisammenseins
entgegen.
Jemand macht eine Ankündigung, dass gleich im Seminarhaus
für alle Interessierten die Diskussionsrunde zur Opfer/Täter
Problematik und den heutigen gesellschaftlichen Fragen beginnt.
Diskussionen - wie viele hatte ich schon geführt? Ein Meister
der Diskussionen war ich gewesen, mit scharfem Verstand und
großer Überzeugungskraft. Was hatte ich gewonnen
mit der zwingenden Logik meiner Argumente, wen hatte ich jemals
wirklich erreicht? Gerade jetzt spüre ich wie Kopfgesteuert,
wie unverbunden mit den Menschen, mit meinem eigenen Herzen,
den tiefen Ängsten und Schmerzen ich war. Gerade jetzt
empfinde ich, dass allein diese Verbundenheit die Wärme,
das Verständnis, das Mitgefühl in mir hervorbringen
kann, aus dem wahrhaftes und dauerhaftes Handeln entspringt.
Wut, Hass und Empörung machen mich starr, entfremden mich
von mir und den Menschen, die ich erreichen möchte. Nein,
Diskussionen habe ich genug gehabt. Ich war nicht gekommen zum
Diskutieren, ich bin gekommen um zu spüren.
Auf der Suche nach netten Gesprächspartnern gehe ich umher,
bleibe aber allein bis ich die geleerte Flasche zurück
gebe. Noch einmal kommt jemand aus der Diskussionsrunde und
fragt, wer ein Sitzkissen auf dem Zimmer hat, das er bereitstellen
kann. Ich mache mich auf den Weg um meines zu holen und trete
damit in das Seminarhaus.
Zwischen 30 und 40 Teilnehmer befinden sich darin. Fleet, einer
der amerikanischen Organisatoren, erzählt gerade von seiner
Vergangenheit, der Schuld, die er als Täter, als Drogendealer
auf sich geladen hat. Vater Manfred ist anwesend. Er spricht
davon wie schwer die Aussöhnung für die Nachfahren
der Täter ist. Wie das Schweigen über die Vergangenheit
als düsterer, bedrohlicher Schatten ihre Kindheit durchzieht.
Ich entschließe mich zu bleiben.
Mark meldet sich zu Wort. Er beginnt mit der Unterstützung,
die die Deutschen nach dem Krieg erhielten und wie wohlhabend,
wie reich sie heute sind. Reicher als die meisten, die sie mit
Krieg und Vernichtung überzogen haben. Dann beleuchtet
er, wie wenig Deutschland im Verhältnis dazu von seinem
Reichtum gibt, um anderen zu helfen, wie klein, peinlich kleinlich
er diesen Beitrag findet. Schlussfolgernd missbilligt er die
deutsche Außenpolitik, ist sein Gefühl, dass diese
Deutschen kein Recht besitzen, groß in der Weltgemeinschaft
mitzureden, dass man sie besser auf die Hinterbänke setzen
sollte. Nachsitzen, schämen sollen sie sich noch immer.
Wieder verstehe ich ihn nur zu gut, denn er spricht aus was
ich selbst empfunden habe. Wenn ich den ganzen Kleinmut, den
Konsumismus, das ängstliche Untertanendenken betrachte
gepaart mit Großmannssucht und Besserwisserei. Deutschland,
Deutschland über alles. Wir sinds, wir wissens, wir könnens.
Ekel erwächst in mir, wenn ich an das Biertischniveau meines
Volkes denke. Selbst heimliche Freude, dass wir schon lange
nicht mehr der Primus in Europa sind und in unserer Herzlosigkeit
aussterben, weil wir keine Kinder mehr zur Welt bringen mögen.
Carol erwidert auf Marks Gedanken. Als Engländerin, lebt
sie seit Jahrzehnten in Deutschland. Sie ist mit Klaus, einem
ebenfalls anwesenden Deutschen, verheiratet.
“Im Alter von 15 Jahren kam mein Sohn eines Tages aufgewühlt
von der Schule. Sie hatten gerade die Verbrechen der Nazis durchgenommen.
Er fragte mich: ‘Mama, Du bist doch keine Deutsche, Du
bist doch Engländerin?‘ Ich bejahte und er sagte:
‘Bin ich froh, dass ich kein richtiger Deutscher bin.‘
In diesem Moment war ich unendlich beschämt über meinen
englischen Stolz und Patriotismus.
Warum hatte mein Sohn kein Recht darauf stolz zu sein als Deutscher?
Er wächst in Deutschland auf, er ist Deutsch und er soll
damit genauso selbstbewusst leben können wie ich als Engländer.”
Auch ich antworte auf Marks Äußerungen, möchte
erklären wie ich mich als Deutscher mit meinem Erbe fühle:
“Ich hatte einen Opa, der in der Nazipartei war. Ich weiß
nicht wie viel Täter er war. Nach dem Krieg wurde er konsequenter
Sozialdemokrat. Jedenfalls wenn meine Schwester als wir Kinder
waren mich ärgern wollte, dann sagte sie zu mir: ‚Du
wirst mal genau so wie der Opa.‘, womit sie seine extrem
herrische und autoritäre Art meinte.
Als ich mit 17 Jahren zum ersten Mal im Konzentrationslager
Buchenwald war, konnte ich kaum glauben, was ich dort sah. Schrumpfköpfe
hergestellt von Ermordeten als Souvenir. Lampenschirme aus menschlicher
Haut. Menschen, die aussortiert und umgebracht wurden, nur um
an ihre tätowierte Haut zu kommen. Ich war so empört,
so voller Abscheu, voller Hass. Wer so etwas tat, der gehörte
nicht mehr zur Menschheit, der gehörte auf immer ausgeschlossen
aus der menschlichen Gemeinschaft. Auf was sollte ich noch stolz
sein? Auf Heisenberg, der versuchte den Nazis die Atombombe
zu bauen? Auf Werner von Braun, der für sie die Raketen
herstellte? Wohin sollte ich mit meinen Gefühlen?
Es mag einfach sein, sich gut als Deutscher zu fühlen,
wenn man diese Gefühle nicht hat, wenn man sich in erster
Linie für sein nächstes schönes Auto interessiert.
Ich könnte bis heute keine deutsche Fahne hissen.
Damals traf ich auch mit Überlebenden des Lagers zusammen.
Menschen, Deutsche, die Widerstand geleistet hatten, gegen die
Nazis gekämpft hatten. Sie beeindruckten mich nicht weniger
als gestern unser Treffen mit Marian. Und die These vom Faschismus
als die letztmögliche, brutalste Herrschaftsform des Kapitalismus
hatte etwas sehr anziehendes für mich. Unbestreitbar war
die massive Förderung der Nazis durch die deutsche Wirtschaft.
Dann musste ich sehen, wie in Westdeutschland die alten Nazis
erneut in den Machtpositionen der Wirtschaft, als Richter, als
Politiker, als Lehrer etabliert waren. So wurde ich Kommunist.
Keine Position, mit der man im Westdeutschland der 80ger Jahre
beliebt war. Heute sehe ich die Einseitigkeit dabei, geboren
aus dem Wunsch zu handeln, auf der richtigen Seite zu stehen.
Auch meine Gewaltbereitschaft als Mittel gegen alte und neue
Nazis lehne ich heute ab. Mir ist klar, dass ich mit dem Hass
auf die Täter, dem Wunsch sie für immer zu verbannen
einen Teil in mir ausschließe, mir die Berechtigung nehme
dazu zu gehören.
Trotzdem finde ich es schwer ein guter Deutscher zu sein. Was
tue ich, wenn in der Straßenbahn Neonazis einen Ausländer,
einen Obdachlosen, einen ‚Linken‘ bedrohen, gewalttätig
werden? Was helfen mir dann Verständnis, Theorien warum
Menschen so werden?
Jeder Mensch, auch ein Deutscher muss sich irgendwie positiv
identifizieren können. Die ersten linken Terroristen in
Deutschland nach dem Krieg waren die Söhne und Töchter
der Tätergeneration. Baader und Meinhoff begannen damit
nachts Kaufhäuser anzuzünden aus Empörung über
die napalmverbrannten Kinder des Vietnamkrieges und die gleichgültige,
nur auf Konsum orientierte Haltung der Deutschen.”
Obwohl ich ausgesprochen hatte was ich empfand, fühle ich
mich nicht sehr wohl nach meinem Beitrag, vielleicht wegen der
Heftigkeit, die aus mir sprach. Die folgenden Beiträge
bestärkten mich in diesem Gefühl, denn sie schienen
mir darauf angelegt Wogen zu glätten, harmonisieren zu
wollen. Zum Schluss folgen wir Fleets Vorschlag und meditieren
gemeinsam einige Minuten. Wir schließen die Augen und
sprechen Fleet nach:
May I be save.
May I be peaceful.
May I be healthy.
May I be at ease...
Beim Verlassen des Seminarhauses frage ich Evelin,
ob sie irgend etwas erschreckt hat an meinem Beitrag oder sie
etwas störend fand.
“Nein, Du hast Deine Meinung gesagt und das war gut.“
Beruhigt und dankbar für ihre Worte gehe ich auf mein Zimmer
und schlafe sofort ein.
Freitag:
Der letzte Tag beginnt wie die vorherigen. Morgendliches Rundgespräch,
Frühstück und der Gang nach Birkenau. Es ist grau
aber nicht mehr so kalt. Noch einmal holen wir Kissen und Matten
aus dem Lädchen am Tor und gehen zu den Gleisen. Kurz hinter
dem Eingang kommt Janina auf mich zu. Kein Wort haben wir seit
unserer Begegnung nach meinem Namenlesen gewechselt. Doch ihre
Präsenz war mir immer gegenwärtig auch bei der Diskussion
vergangene Nacht.
“Ich möchte Dir sagen: Du bist das Beste, was Deinem
Großvater passieren konnte.”
Wieder bin ich gerührt von ihren Worten, werden meine Augen
feucht.
“Danke”, ist alles was ich sagen kann.
Janina lässt mich allein.
Warum fällt es mir so schwer kein hässlicher Deutscher
zu sein, anzunehmen, dass ich ein guter Mensch bin?
Nach der Meditation gehen wir zum Ascheteich.
Ein gemeinschaftlicher Gottesdienst aller vertretenen Religionen
wird zum Gedenken der Opfer von Auschwitz abgehalten. Er endet
damit, dass wir uns an die Händen nehmen und laut singend
um den Teich laufen.
“...wie ein Phönix aus der Asche...”, lautet
eine Stelle im Text.
Dann folgt die letzte Mittagssuppe vor den Toren
von Birkenau. Danach treffen wir uns noch einmal in der Baracke
nahe dem Eingang wie am Abend zuvor.
Im Schein der Kerzen sitzen wir für einige Minuten in Stille.
Nochmals werden Namen verlesen von Opfern, gefolgt von einer
weiteren Periode des Schweigens. Schließlich sprechen,
rufen, singen wir alle gleichzeitig die Namen von den Listen,
ein letztes Mal. Abschließende Worte, Wünsche und
dann kommt das große Umarmen.
Wie habe ich diese Umarmungen genossen. Unbefangen
den anderen umschließen, spüren in seiner ganzen
Körperlichkeit, seiner Präsenz, seiner Nähe,
unserer Verbundenheit. Wie selten habe ich mich so dazugehörig,
so wenig ausgeschlossen gefühlt. Es tat so gut all diese
Menschen zu drücken, von ihnen gedrückt zu werden.
Nicht getrennt, nicht allein, nicht einsam sein...
Vor der Rückkehr zur Jugendherberge wohnen
wir in der Baracke der Aufnahmezeremonie von Nina und Damian
in die Peacemaker Gemeinschaft bei. Damian, der junge Pole aus
meiner Concilgroup und Nina, eine junge Frau aus Deutschland...
Ich nehme den Fußweg zur Jugendherberge.
Als ich die Felder hinter mir gelassen habe wende ich mich und
schaue ein letztes Mal auf das Lager. Vertraut ist es mir geworden
in dieser kurzen Zeit. Meinen Dank an das polnische Volk, dass
sie es so wunderbar für uns erhalten haben.
Sabbat
Festlich gedeckte Tische stehen für uns im Foyer bereit.
Die meisten Teilnehmer sind ein wenig mehr herausgeputzt als
sonst, besonders die Frauen. Rabbi Ohad läutet das Abendessen
ein. Gewappnet mit Wein und Wodkaglas zum Aperitif lausche ich.
Seine Geschichten zum und über den Sabbat vorgetragen auf
die ihm eigene herzliche und gewitzte Art stimmen uns auf den
Abend ein. Die Atmosphäre ist gelöst. Jetzt soll gefeiert
werden.
Zum ersten Mal in dieser Woche gibt es Fleisch das heißt
Fisch als Hauptgang.
Nach dem Essen folgt ein Programm. Jeder der mag und kann ist
dazu aufgerufen einen Beitrag zu leisten. Damian macht den Anfang
mit einer One Man Pantomimen Show. Das Publikum ist begeistert.
Durcheinander folgen Lieder, Sketche, Geschichten, Gedichte,
Gitarren- und Flötenspiel.
Ich fühle mich wohl, plaudere hier und da, verfolge die
Darbietungen. Gegen zwei haben sich die Reihen schwer gelichtet.
Die meisten müssen in aller Frühe den Bus zurück
nach Krakau nehmen. Amelie und ich werden von Pawel, dem polnischen
Mathematikprofessor, im Wagen bis nach Breslau mitgenommen und
steigen dort in den Zug. So sitze ich am Ende mit den Verbliebenen
und singe zur Gitarrenbegleitung:
“How could anyone ever tell you,
that you are anything less than beautiful.
How could anyone ever tell you,
that you are less than whole...”
Wieder und wieder erschallt Lorena McKenneth‘s
Song und ich fühle eine tiefe, tiefe Verbundenheit mit
meiner Frau, meinen Kindern, mit allen Menschen, allen empfindenden
Wesen dieser Welt ...
und mit mir selbst.
Im Zug
Beim Frühstück saß ich neben Mark. Er und Daniel
befinden sich am Anfang einer Weltreise. Sie werden noch weiter
in Osteuropa reisen und dann nach Bombay, den indischen Subkontinent
erforschen. Er fragte mich, wie ich zu seinem Beitrag am Donnerstag
Abend stände. Ich antwortete: “Ich dachte, was könntest
Du anderes empfinden?”
Den Tag haben Amelie und ich mit Zugfahren und in Cafés
von Breslau und Poznan verbracht. Jetzt sitzen wir im Nachtzug.
Draußen beginnt es dunkel zu werden. Meine Gedanken schwirren
umher. Im Rucksack wartet das Computerbuch. Doch ich rühre
es nicht an, werde es nicht mehr hervorholen auf dieser Fahrt.
Was nehme ich mit von dem Ort, wo alle meine gewohnten Maßstäbe
lächerlich scheinen? Was bleibt in meinem Alltag, in einer
Gesellschaft, deren “Schneller, Höher, Weiter”
ich immer weniger verstehe, fragen möchte: Wohin? Warum?
|